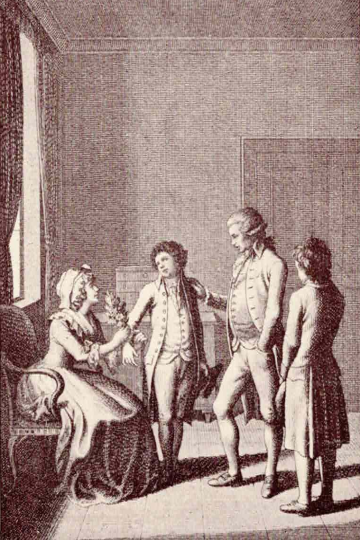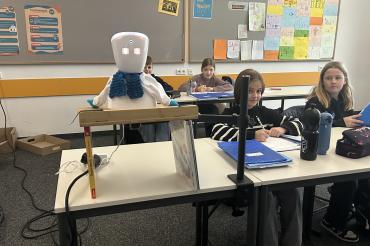Von Gastautorin Friederike Rieger
1704: Tragische Liebe
Es war eine Liebe zur Zeit des Spanischen Erbfolgekrieges. Und es war Liebe auf den ersten Blick zwischen dem Leutnant Anton Leopold, Sohn des Feldmarschalls Johann Baptist Graf von Arco, und der Sonnenwirtstochter Wally Mozler. Der Kaisheimer Pfarrer Anton Endres erzählt 1867 in seinem Fortsetzungsroman „Die Schlacht auf dem Schellenberge den 2. Juli 1704“ über diese tragische Liebe. Der Krieg, der Europa erschütterte, brachte wieder einmal Einquartierungen von Tausenden von Soldaten bei Donauwörther Bürgern mit sich. Die Soldaten sollten sich auf dem Schellenberg verschanzen und den Übergang über die Donau verteidigen.
Beim Sonnenwirt Georg Mozler in der Sonnenstraße wurden ab dem 15. Juni bayerische Offiziere untergebracht. Während dieser Zeit entwickelte sich eine zarte Liebe zwischen Graf Anton und der Sonnenwirtstochter Wally, die Pfarrer Endres empfi ndsam beschrieb. Beim tränenreichen Abschied vor der Schlacht und dem Schwur ewiger Liebe versprach Graf Anton Wally, sie trotz der Standesunterschiede zu heiraten. Das Abschiedsgeschenk, eine Haarlocke von Wally, wollte er während der Schlacht als Talisman auf seinem Herzen tragen.
Um 6 Uhr abends am 2. Juli 1704 begann mit dem Sturm auf die Schanze auf dem Schellenberg eine der grausamsten Schlachten des Spanischen Erbfolgekrieges. Todesmutig versorgten Wally und ihre Schwester Therese die Verwundeten auf dem Schlachtfeld. Zahlreiche Soldaten und Offiziere mussten auf dem Schellenberg ihr Leben lassen, unter anderem auch Anton Leopold, der in den Armen seiner geliebten Wally starb. Der Kalvarienberg in Donauwörth erinnert an diese blutige Schlacht.
1780: Verbotene Liebe
Es war Liebe auf den ersten Blick! Die erste Begegnung zwischen Bruder Bonifacius vom Benediktinerkloster Heilig Kreuz in Donauwörth und Minchen, der schönen Tochter des Salzbeamten. Anlass war 1780 die weltliche Feier der Primiz eines Mitbruders und Freundes von Bonifacius – im bürgerlichen Leben Franz Xaver Bronner, der 1758 in Höchstädt geboren wurde und 1776 ins Kloster eingetreten war. Zum ersten Rendezvous zog sich der verliebte Mönch mit seiner Angebeteten in ein Nebenzimmer zurück, wo Pater Gregor Bühler mit gefühlvollen Klaviersonaten das Tete à Tete begleitete. Es folgte ein sehnsuchtsvoller Briefwechsel mit Minchen, wobei der Vater als „Postillon d’amour“ amtierte. Gallus Hammerl, der Abt des Klosters, drückte vermutlich bei seinen jungen Mönchen nachsichtig beide Augen zu, wenn sie die Grenzen zum weiblichen Geschlecht sehr weit steckten. Galanterie war im Rokoko eben an der Tagesordnung! Nach dem ersten Kuss in der Wohnung Minchens folgten Herzensgeschenke, unter anderem eine Aderlassbinde für den jungen Mönch.
Ein Jahr sollte diese zarte Liebesgeschichte dauern, dann wurde Minchen mit einem Witwer verheiratet. Am Hochzeitstag bekam Bronner einen tränenreichen Brief, in dem Minchen ihm ewige Treue schwor, und einen damals bei Hochzeiten in Donauwörth üblichen Strauß mit Rosmarin und Zitrone. Mit einem zarten Kuss in Anwesenheit des Ehemannes endete diese Liebesgeschichte.
1823: Märchenhafte Liebe
Wie ein Blitz aus heiterem Himmel schlug die Nachricht aus Wallerstein in ganz Bayern ein: Ein Fürst, der in Landshut studiert hatte, verzichtet wegen der Liebe zur Gärtnerstochter auf Karriere und Ämter! Am 7. Juli 1823 hatte Fürst Ludwig Kraft Ernst von Oettingen-Wallerstein in der Dorfkirche von Kerkingen Crescentia Bourgin, die siebzehnjährige Tochter des Hofgärtners, geheiratet. Kennengelernt hatte der Fürst die bildschöne Tochter seines Gärtners bei Jagdaufenthalten
in Hohenbaldern. Er kümmerte sich persönlich um ihre Erziehung, besorgte ihr einen Musiklehrer und eine kleine Hausbibliothek. Im Januar 1823 starb Crescentias Mutter und der junge Fürst weilte mit an ihrem Sterbebett. Vielleicht hat dieser Moment seinen Entschluss bestärkt, Crescentia zu heiraten. Heimlich reiste er mit seiner Braut nach Sedan, wo ein Onkel Crescentias die Stelle eines Stadtpfarrers innehatte. Der weigerte sich aber, die Trauung zu vollziehen, da die nötigen
Papiere fehlten.
In Rottenbuch erlangte das Brautpaar die bischöfliche Dispens und ließ sich noch am Abend der Rückkunft in Kerkingen vom Dorfpfarrer trauen. Durch die nicht standesgemäße Heirat musste der Fürst auf die Erstgeburtsrechte verzichten und verlor alle Ämter. Deshalb wohnten der Fürst und seine junge Gemahlin für kurze Zeit im Kloster Heilig Kreuz in Donauwörth, das dem Fürstenhaus Oettingen-Wallerstein seit der Säkularisation gehörte. Hier wurde 1824 die Tochter Caroline geboren und in der Klosterkirche Heilig Kreuz getauft. Fast dreißig Jahre stand Crescentia ihrem Gatten in glücklicher Ehe zur Seite, eine stille, schüchterne Frau von großer Herzensgüte. Am 22. Juni 1853 starb Crescentia an einem Herzleiden. Ihr Porträt und das Porträt ihrer Tochter Caroline hängen in der Schönheitengalerie König Ludwigs I.
1826: Späte Liebe
Eine „späte Liebe“ ist die Liebe zwischen Elisabeth Heiland und Joseph Schoderer. Elisabeth, die Tochter des Säcklermeisters Adam Kress wird am 10. Januar 1791 in der Kirche Sankt Georg in Nördlingen auf den Namen Rebekka Elisabeth getauft. Ihr späterer Mann Joseph Schoderer wurde am 10. Juni 1770 als Sohn des Kaufmanns Godefridus Schoderer geboren. Im Alter von fünf Jahren, im Jahr 1796, wurde Elisabeth vom Hof-Handschuhmacher Joseph Heiland aus Wallerstein für 50 Gulden, die ihr Vater Joseph Heiland schuldete, gekauft und an Kindes statt angenommen. Unter dem Namen Elisabeth Heiland wächst sie im katholischen Elternhaus in Wallerstein auf. Joseph Schoderer heiratete 1795 zunächst Maria Crescentia Dietrich und eröffnete in der Reichsstraße in Donauwörth ein Weingeschäft. Er wird 1806 als Gegner Napoleons verhaftet und soll in Braunau hingerichtet werden.
Elisabeth ist ab 1808 in der Sonnenwirtschaft in Donauwörth, die ihr Vater gekauft hatte, für das neu eingerichtete Kaffee und den Billardtisch verantwortlich. Die männlichen Gäste, vor allem die Herren vom Landgericht, machen Elisabeth den Hof. Doch ihr Herz schlägt für Joseph Schoderer, einen einsamen älteren Herrn, der als täglicher Gast gern guten Kaffee bei „Jungfer“ Elisabeth trinkt. Der eifersüchtige Vater Elisabeths ist mit der Liebesbeziehung zwischen seiner Tochter und Schoderer nicht einverstanden. Trotzdem heiratet die 35-jährige Sonnenwirtstochter Elisabeth Heiland den 56-jährigen Witwer Joseph Schoderer. Der „späten Liebe“ zwischen Joseph und „Lisette“ waren nur fünf Jahre gegönnt, denn 1831 stirbt Joseph Schoderer. Die Schriftstellerin Ottilie Wildermuth hat – bezugnehmend auf Unterlagen Leonhard Kremers – in ihrem Roman „Zweimal verkauft“ die Liebesgeschichte aufgeschrieben. Dieser hat Ludwig Auer zu dem Theaterstück „Schoderers Lebensabend“ inspiriert.