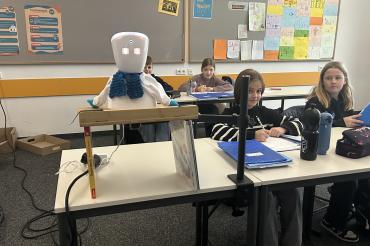Hallo Herr Schäpers, vielen Dank, dass Sie sich für unser Interview Zeit nehmen. Was hat Sie denn heute schon beschäftigt und was steht heute noch auf Ihrer Agenda?
Branko Schäpers: Ich habe mich heute schon auf unser Interview vorbereitet. Tja und dann hatte ich heute leider schon einen Auffahrunfall. Aber alles halb so wild, es ist nur ein kleinerer Blechschaden. Ansonsten steht noch ein wichtiger Termin mit
unserem Steuerberater an, der Jahresabschluss steht bevor. Da sind noch einige wichtige Dinge zu klären.
Um Sie besser kennenzulernen, einige Entweder-Oder-Fragen
Film oder Serie?
B. S.: Das kommt immer ganz darauf an. Ich schaue ganz gerne Serien an, Vikings habe ich sehr gerne geschaut. Ich glaube dreimal oder so. (lacht) Ich bin aber auch ein großer Star-Wars-Fan, seit meiner Kindheit. Das erste Mal habe ich Star Wars gesehen, das war noch in Jugoslawien, auf Englisch damals mit Untertitel. Ich glaube, da habe ich auch jeden Teil mehrfach angeschaut.
Sport schauen oder Sport machen?
B. S.: Eher machen. Ich mache zweimal die Woche Ju-Jutsu bei der Airbus Helicopters Sportgemeinschaft. Ich schaue auch Sport, ich fiebere mit, wenn zum Beispiel Fußball-WM ist und Deutschland noch dabei ist.
Abenteuer-Urlaub oder All Inclusive?
B. S.: Ich würde gerne Abenteuer- Urlaub machen, aber das haut mit der Familie aktuell noch nicht ganz hin. Die Kinder sind noch zu klein dafür. Bei All Inclusive da weiß man einfach, was man gebucht hat, das bekommt man auch. Beides hat seinen Reiz.
Sie sind 1991 während des Jugoslawien-Konfliktes nach Deutschland gekommen.
Können Sie uns mehr über Ihre Kindheit erzählen?
B. S.: Ich bin in Serbien, damals noch Jugoslawien, in der nördlichen Provinz Vojvodina geboren. Das war damals eine vergleichsweise wohlhabende Gegend in der Nähe von Belgrad. Ich hatte eine ganz normale Kindheit. Was man als Kind so macht, Schule und ganz viel Unsinn eben. Quasi parallel zum Kriegsbeginn sind wir 1991 nach Deutschland gezogen. Mein Vater ist Deutscher, das war also unproblematisch. So ein Umzug war aber natürlich schon eine Herausforderung.
Was waren weitere Stationen in Ihrem Leben?
B. S.: Ich bin dann auf die Hauptschule gegangen, konnte aber aufgrund der sprachlichen Schwierigkeiten damals keinen
höheren Schulabschluss machen. Im Anschluss habe ich eine handwerkliche Ausbildung zum Konstruktionsmechaniker, also Schlosser gemacht. Danach war ich zwölf Jahre bei der Bundeswehr in Donauwörth stationiert. So bin ich erstmalig hierhergekommen. Bei der Bundeswehr war ich im Bereich elektronische Kampfführung tätig und auch viermal im Auslandseinsatz – dreimal im Kosovo und einmal in Mazedonien. Seit 2012 bin ich bei der Caritas. Ich habe während meines Studiums ein Praxissemester in einer Tagesstätte für psychisch kranke Menschen bei der Caritas in Neuburg an der Donau gemacht. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, sodass ich dort noch länger gejobbt habe während meines Studiums. Durch Zufall bin ich dann über eine Stellenausschreibung für die damalige Möbelfundgrube in Donauwörth gestolpert. Dort habe ich angefangen und nach dem Ende meines Studiums habe ich rechtliche Betreuungen übernommen.
Was hat Sie dazu gebracht, vom Handwerk und Militär zur sozialen Arbeit zu wechseln?
B. S.: Es gab nicht das prägende Erlebnis, das mir gezeigt hat, ich werde jetzt Sozialarbeiter. Das war ein langer Prozess, der sich entwickelt hat. Ich kann aber beiden Berufen etwas Gutes abgewinnen, sowohl dem Handwerk als auch der Bundeswehr. Ich bereue diese Zeit nicht. Wenn ich noch einmal 19 wäre, würde ich es auf jeden Fall noch einmal so machen.
Sehen Sie zwischen Bundeswehr und Caritas auch Gemeinsamkeiten – etwa im Einsatz für andere oder im Thema Verantwortung?
B. S.: Letztlich ähneln sich beide Bereiche doch ein Stück weit, auch wenn das auf den ersten Blick nicht so erscheint. Es geht bei beiden darum, andere zu unterstützen und zu helfen – auch wenn die Methoden durchaus unterschiedlich sind. Die Erfahrungen, die ich bei der Bundeswehr machen konnte, helfen mir natürlich. Bei der Bundeswehr hat man sehr klare, sehr starre Strukturen. Auch das hierarchische Denken war seinerzeit sehr ausgeprägt, aber es ist jetzt fast 20 Jahre her, dass ich ausgeschieden bin. Die Strukturen gibt es auch bei der Caritas im Kreisverband, wir sind in ein größeres Ganzes eingebunden. Ich habe hier als Geschäftsführer ebenfalls einen Auftrag, den ich so gut es geht, erfüllen möchte.
Sie sind seit 2015 Geschäftsführer des Caritasverbandes Donau-Ries e.V.
Welche Aufgaben hat der Caritasverband im Landkreis?
B. S.: Der Deutsche Caritasverband ist mit rund 700 000 Mitarbeiter*innen der größte nicht-staatliche Arbeitgeber in Deutschland. Im Landkreis Donau- Ries haben wir im Wesentlichen zwei Säulen, eine dritte ist gerade im Aufbau. Die erste Säule ist die gemeindeorientierte Sozialarbeit, diese beinhaltet unter anderem die allgemeine Sozialberatung – von der Schuldnerberatung bis hin zu den zwei Tafeln in Donauwörth und Nördlingen mit den zusätzlichen Ausgabestellen in Wemding und Bäumenheim. Die zweite Säule ist die Sozialpsychiatrie, also die Unterstützung von Suchtkranken, behinderten Menschen sowie psychisch Erkrankten.
Wie würden Sie die Rolle des Geschäftsführers in einem Wohlfahrtsverband wie der Caritas beschreiben? Inwiefern unterscheidet sich Ihre Arbeit von der eines Geschäftsführers in einem Unternehmen der freien Wirtschaft?
B. S.: Der Unterschied liegt vielleicht in der Ausbildung. Ich unterstelle jetzt, ohne es zu wissen, dass ein Geschäftsführer eines vergleichbaren Unternehmens ein betriebswirtschaftliches oder juristisches Studium absolviert hat. Ich bin Sozialpädagoge und habe ein Fernstudium im Bereich Betriebswirtschaft für Non-Profit-Organizations. Bei der Caritas geht es nicht um Gewinnmaximierung. Wir nehmen uns Projekten an oder finanzieren diese, bei denen wir von vornherein wissen, dass diese keine schwarzen Zahlen schreiben werden.
Die Caritas ist ein kirchlicher Verband – inwiefern prägt das Ihre Entscheidungen im Alltag?
B. S.: Dass die Caritas ein kirchlicher Verband ist, prägt meine Entscheidungen im Alltag natürlich. Da sind wir wieder ein bisschen bei dem Thema, dass wir Dinge übernehmen und finanzieren, bei denen wir davon ausgehen, dass keine schwarze Null dabei rauskommen wird, sondern eher ein rotes Minus. Durch Mittel aus der Kirchensteuer, die über das Bistum, beziehungsweise den Diözesancaritasverband an uns weitergereicht werden, haben wir hier größere Spielräume. Die Caritas ist die dritte Säule der katholischen Kirche, der ausgestreckte Arm in die Gesellschaft. Ich bin mir gar nicht sicher, ob alle, die zu uns kommen, wissen, dass sie sich in eine kirchliche Einrichtung begeben. Aber das spielt auch gar keine Rolle. Jeder Mensch ist bei uns willkommen, unabhängig davon, ob man einen katholischen, muslimischen oder anderen Glauben hat.
Die Caritas betreibt im Landkreis Donau-Ries die Tafel. Diese soll eine Brücke schaffen zwischen Überfluss und Mangel.
Warum ist es aus Ihrer Sicht wichtig, dass ein Wohlfahrtsverband diese Aufgabe übernimmt?
B. S.: Es ist die ureigenste Tätigkeit eines christlichen Wohlfahrtsverbandes. Man kann auf die Evangelien zurückgehen, als der barmherzige Samariter, der das, was er zu viel hatte, geteilt und abgegeben hat. In unserer Gesellschaft gibt es Menschen, die mit einem Mangel leben müssen und auf der anderen Seite gibt es die Geschäfte oder Privatpersonen, die etwas zu viel haben und spenden möchten – sei es Lebensmittel, Geld oder Zeit. Rund 2.400 Menschen kommen im Landkreis Donau-Ries zur Tafel. Das sind etwa zwei Prozent der gesamten Landkreisbevölkerung, das ist durchaus eine nennenswerte Gruppe, die über die Tafel entsprechend versorgt wird. Das hat für die Menschen zwei positive Effekte. Einerseits bekommen sie günstiger Lebensmittel. Ein Lebensmittelpaket kostet pro Erwachsenen drei Euro. Andererseits haben sie so mehr Spielraum für andere Anschaffungen, für Unternehmungen mit ihren Kindern oder für Kultur. Man darf aber natürlich den ökologischen Aspekt nicht ausklammern. Ein Teil der Lebensmittel, die weitergegeben werden, würden sonst in der thermischen Verwertung landen.
Welche Rolle spielt die Tafelarbeit innerhalb der gesamten sozialen Angebote der Caritas?
B. S.: Nun komme ich auch auf eine weitere Säule des Caritas-Kreisverbandes zu sprechen. Wir bieten die Möglichkeit für bürgerschaftliches Engagement. Rund 170 Ehrenamtliche engagieren sich im Landkreis bei den beiden Tafeln. Das ist schon eine Hausnummer. Letztendlich sind das zwei Kleinbetriebe, die selbstorganisiert arbeiten und fast ausschließlich aus ehrenamtlicher Kraft funktionieren. Mit allem, was man sich vorstellen kann: Dienst- und Tourenplan, Arbeitssicherheit und -schutz, Hygieneschulungen, Fahrsicherheitstrainings, etc.
Wie stark ist die Nachfrage in den letzten Jahren gestiegen – und worauf führen Sie diese Entwicklung zurück?
B. S.: Die Nachfrage ist massiv angestiegen. Natürlich war die Corona-Pandemie eine besondere Zeit. Damals haben wir einen Lieferdienst eingerichtet für die Betroffenen. Diese Menschen befinden sich in einer Krise und dann kommt auch noch Corona und der Lockdown dazu. Die Tafel zu schließen war daher keine Lösung. Wir haben uns für den Lieferdienst entschieden, um keine großen Menschenansammlungen in und vor der Tafel zu haben. Das war eine sehr gute Entscheidung, die ich heute nochmal so treffen würde. Eine große Hilfe war in dieser Zeit die Reservistenkameradschaft in Nördlingen. Sie waren sehr aktiv und ich bin immer noch dankbar, dass sie uns so unterstützt haben. Ja, und dann kam das Jahr 2022 und ab da ging es stetig nach oben, an beiden Standorten. Wir haben Kundenanstiege von circa 50 Prozent. Wir sind damals davon ausgegangen, dass es mehr wird und dann aber wieder weniger wird. Tatsächlich ist es jedoch so, dass sich die Zahlen auf dem sehr hohen Niveau eingependelt haben. Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass mindestens die Hälfte geflüchtete Menschen sind, die andere Hälfte sind Geflüchtete, die schon länger hier leben, Bürgergeldbezieher, Geringverdiener und Aufstocker.
Neben der Tafel engagiert sich die Caritas im Landkreis auch in vielen weiteren sozialen Bereichen
Sie haben mit eco residential GmbH einen Kooperationsvertrag für ein Projekt seniorengerechtes Wohnen in Nördlingen angekündigt. Welche sozialen Leistungen und Angebote sollen dort umgesetzt werden?
B. S.: Ein Bauträger ist vor rund anderthalb Jahren auf uns zugekommen mit der Idee im Eger-Viertel in Nördlingen eine Wohnanlage zu bauen. Im Rahmen dieses Projektes sollen auch 22 bis 24 Wohnungen als betreutes Wohnen für
Senioren ausgewiesen werden. Mittlerweile sind die Details vertraglich festgeschrieben und die Pläne stehen. Sollte
alles reibungslos laufen, dann werden die Wohnungen ab dem Jahr 2027 bezugsfertig sein. Die Caritas Donau-Ries übernimmt die Betreuung der betreuten Wohnungen. Einzugsberechtigt sind Menschen ab 60 Jahren oder mit einem entsprechenden Grad der Behinderung. Wir als Sozialverband übernehmen die organisatorische Unterstützung der Bewohner, z.B. bei der Suche nach einem Pflegedienst, einem Hausnotruf oder bei täglichen Erledigungen. Einen Teil davon bieten wir im Rahmen des ambulanten Betreuungsdienstes selbst an. Entstehen werden 1- bis 4-Zimmer-Wohnungen. Die Caritas plant gemeinsam mit
einem Investor auch in Monheim ein Projekt – eine Tagespflege-Einrichtung.
Wie ist es dazu gekommen?
B. S.: Vor knapp zwei Jahren habe ich einen Artikel in der Presse gelesen, dass man gerne eine Tagespflege-Einrichtung in der Stadt haben würde, aber keinen Träger findet. Ich habe dann kurzerhand Bürgermeister Pfefferer angerufen und mit ihm darüber gesprochen – mit Erfolg. Die Firma Kratz wird das Gebäude bauen und als Vermieter fungieren. Die Bauzeit ist auf rund anderthalb Jahre angesetzt. Entstehen soll eine Einrichtung mit 20 Plätzen für Senioren.
Sprechen wir zum Ende unseres Interviews gerne noch über die Privatperson Branko Schäpers
Ihre Arbeit ist oft mit schweren Schicksalen und sozialer Not verbunden – wie schaffen Sie es, emotional Abstand zu halten oder zur Ruhe zu kommen?
B. S.: Man kommt natürlich mit schwierigen Themen wie Obdachlosigkeit, Suchterkrankungen oder Verarmung in Berührung. Das nagt manchmal schon an einem. Sport hilft mir auf der einen Seite natürlich total Abstand zu bekommen oder auch Zeit zu Hause mit meinen Kindern zu verbringen, aber auch sich einfach dessen bewusst zu sein, dass man alleine die Welt nicht retten kann. Es wird immer diese Probleme geben, aber wir können unseren Teil dazu beitragen und helfen. Wenn man aber den beruflichen Weg in die soziale Arbeit geht, dann muss man sich diesem schon voll bewusst sein. Nicht umsonst ist die Burnout-Quote insbesondere in sozialen Berufen vergleichsweise hoch.
Wie gehen Sie mit dem Druck um, dass man im sozialen Bereich nie „fertig“ ist?
B. S.: Das ist auch so ein Punkt, mit dem man einfach leben muss. In einer perfekten Welt bräuchte man die Caritas erst gar nicht. Das ist so der Widerspruch der sozialen Arbeit. Wir versuchen darauf hinzuarbeiten, dass man uns abschaffen kann. Das werden wir aber nicht erreichen. Man muss sich einfach bewusst sein, dass man an einem Tag nicht alles schaffen kann, was man eigentlich gerne würde.